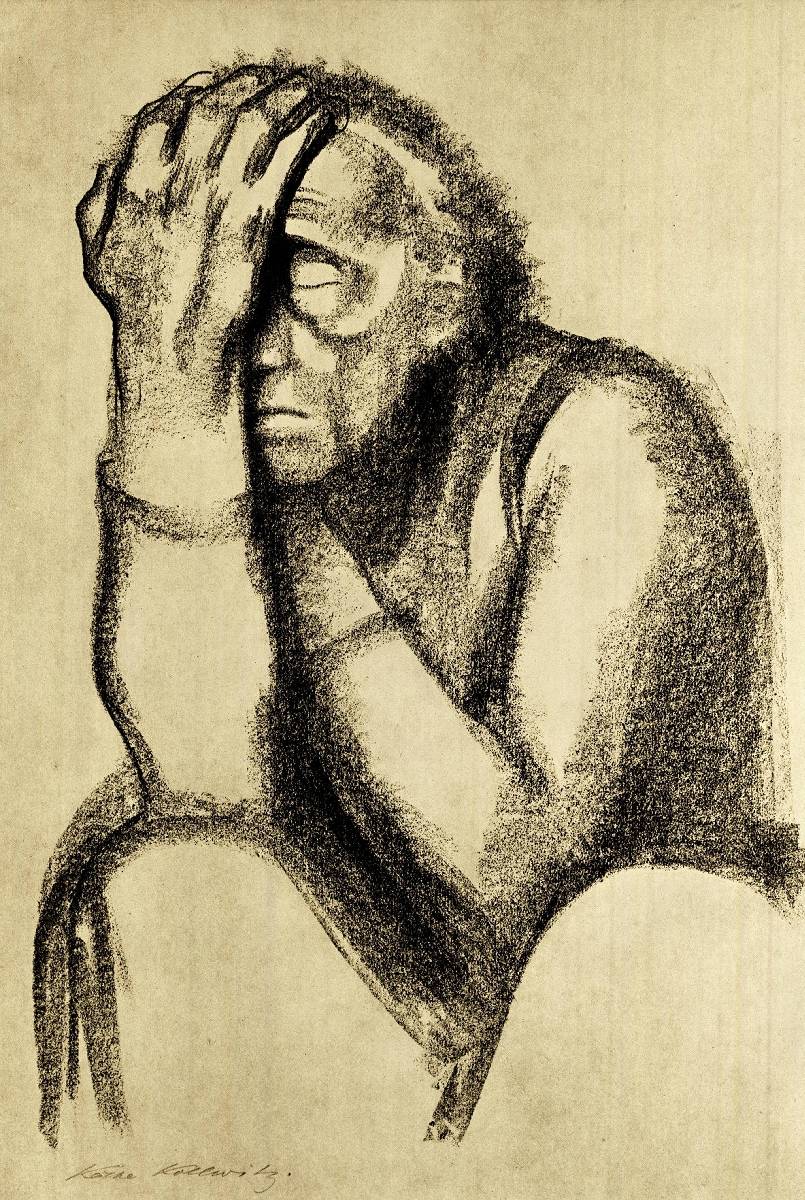Vor zehn Jahren wurde das Stück Neunzehnachtzehn von Ihrer Frau Andrea Paluch und Ihnen uraufgeführt. Wie kam es zu dieser Auftragsarbeit?
Interview mit Robert Habeck „Ja, wir können Revolution“
Der Grünen-Chef ist auch Schriftsteller und spricht über sein mit seiner Frau vor zehn Jahren verfasstes Theaterstück „Neunzehnachtzehn“ zum Matrosenaufstand in Kiel vor hundert Jahren, das im Dezember wiederaufgeführt wird.
Habeck Der damalige Intendant des Kieler Theaters, Markus Grube, fragte uns, ob wir nicht ein Stück für das Theater Kiel schreiben wollten. Wir wollten ein politisches Ereignis in Kiel thematisieren. Es hätte auch um die Nichtwahl von Heide Simonis oder den Tod von Uwe Barschel gehen können. Aber der Matrosenaufstand 1918 war das bedeutsamste Ereignis der Stadtgeschichte.
Auf was waren Sie besonders neugierig?
Habeck Ich bin zwar in Kiel großgeworden, inmitten von Orten also, die beim Matrosenaufstand eine Rolle spielten, aber ich kannte die Hintergründe nicht. Im Landtag wurden damals die Kadetten der Marine ausgebildet, das frühere Gewerkschaftshaus lag 50 Meter neben der damaligen Grünen-Geschäftsstelle. Wo wir abends Pommes aßen, wurden die ersten revolutionären Flugblätter gedruckt. Ich entdeckte als Kieler meine eigene Stadt noch mal neu. Und ich glaube, das geht mit dem Stück vielen Kielern so.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Habeck Die Figur des Gustav Noske, der sozialdemokratische Politiker, der nach Kiel geschickt worden war, um die Lage zu beruhigen. Er wurde zum zweiten Antrieb für das Stück. An ihm hängten wir die Frage auf: Wie wird aus der Angst der Matrosen, noch für einen sinnlosen Angriff auf England verheizt zu werden, und dem Impuls zum Widerstand dann eine Struktur und eine Bewegung? Noske wurde später zum selbst ernannten Bluthund der Regierung Ebert, der als Innenminister den Spartakusaufstand niederschießen ließ und das Bündnis mit den alten Eliten schuf. Das Stück handelt auch davon, wie Noske Noske wurde. Wie er sich zunächst weigert, ein aktiver Teil der Revolution zu werden, dann einen Beitrag leisten wollte und dabei die Revolution abwürgte. Leidenschaft und Kompromiss können so zu einer Alternative zwischen schlecht und schlechter führen. Das ist eben auch Politik.
Haben Sie die Erkenntnis gewonnen, dass die Deutschen doch Revolution können?
Habeck Ja, wir können Revolution. Wir sollten viel selbstbewusster auf die revolutionären Bewegungen der Vergangenheit schauen. 1848, 1918, 1968 und dann die friedliche Revolution von 1989: Es stimmt nicht, dass es nur eine Geschichte des Scheiterns ist. Die Revolution von 1918 hat zwar nicht zu einer stabilen Demokratie geführt, aber sie hat den Ersten Weltkrieg beendet. 1848 hat die Revolution nicht zu einer modernen Republik geführt, aber sie hat die Grundlagen für unsere Verfassung und die europäische Grundrechtscharta gelegt. Und die Revolution von 1968 hat mit dem Gang durch die Institutionen dazu geführt, dass die Gesellschaft freier, liberaler wurde und eine erweiterte Rechtsstaatlichkeit entwickelte. Und 1989 wurde ein Unrechtsregime beendet, ein Land wiedervereinigt und ein Kontinent gleich mit. Auch wenn in den Jahren danach nicht alles gut gelaufen ist, Menschen im Osten enorme Brüche erlebt haben – der 9. November 1989 hat die Welt verändert.
Wie viel „Wir sind das Volk“ steckt in den Kieler Matrosen des Jahres 1918?
Habeck Das kommt auf das Verständnis von „Volk“ an. Die Matrosen haben wenig mit dem deutschen Volk zu tun. Ihnen ging es um eine Versöhnung mit den kämpfenden Einheiten auch auf der anderen Seite der Front. Die meuternden Matrosen suchten die Verständigung mit den Soldaten, auf die sie eben noch geschossen hatten, mit den Franzosen, den Belgiern, den Engländern und den Amerikanern. Sie schmiedeten eine internationale Solidarität gegen die feudalen Kriegsherren. Sie machten sich vom Befehlsempfänger zum mündigen Bürger. Wenn aber „Volk“ meint, dass Menschen das Schicksal in diesem Land in die Hand nehmen und aus Verantwortung für Veränderungen streiten, dann stehen die Matrosen von 1918 trotz oder wegen ihrer roten Fahnen in der besten Tradition der deutschen Demokratie.
Das Stück handelt von Macht und Moral. Wie oft denken Sie im politischen Alltag in diesen Kategorien von 1918?
Habeck Macht heute zu haben oder auszuüben, bedeutet, durch Wahlen Mandate zu erlangen und durch Verhandlungen Einfluss auf die Gestaltung zu gewinnen. Aber als Parteivorsitzender denke ich gar nicht so viel über Macht nach. Ich glaube, dass die von alleine kommt, wenn wir die richtigen Themen richtig adressieren. Die dümmste Ansage wäre: „Wir sind die beste Partei.“ Wir müssen stattdessen über das Gespräch Zuspruch gewinnen. Mit dem Stichwort Moral verhält es sich komplizierter. Denn Moral kann den Kampf um das politische Argument ausbremsen. Aber eine Politik, die jegliche Moral über Bord wirft, ist nicht nur ohne Orientierung und Werte, sondern gefährlich. Wenn nicht mehr gilt, dass wir in dem anderen uns selbst erkennen, dass wir Menschen als Menschen sehen, dann wird es gespenstisch.
Würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen der letzten zehn Jahre heute einzelne Passagen anders schreiben als bei der Uraufführung?
Habeck Alles, was man schreibt, ist auch ein Produkt seiner Zeit. Das Stück akzeptiere ich so, wie es ist. Klar würde ich es heute anders schreiben, ich bin ja zehn Jahre älter und habe zehn Jahre weitere Erfahrungen gesammelt. Das Gute an Theateraufführungen ist aber, dass durch die Inszenierung ein Stück in eine veränderte Wirklichkeit hineingetragen werden kann. Nach allem, was ich gehört und gesehen habe, wird das bei den neuen Vorstellungen in Kiel auch so sein.
Gehen Sie hin?
Habeck Ja klar!
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Habeck Als ich vor kurzem zum ersten Mal nach dem Ausscheiden aus dem Ministeramt wieder in Kiel war und etwas Zeit hatte, bin ich zu einer Probe gegangen und dann mit den Schauspielern von Handlungsort zu Handlungsort gezogen. Ich geriet in die Szene des ersten Arbeiter- und Soldatenrates. Es war faszinierend, zu sehen, wie die Schauspieler noch ohne Kostüme, also mit Rucksäcken und in ihren normalen Klamotten spielten – also eine ganz gegenwärtige Revolution. Auf diese Szene freue ich mich besonders.