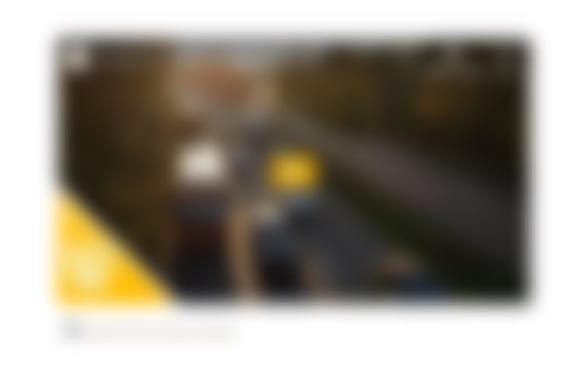Erinnerungen unserer Leser „Einmal Kumpel, immer Kumpel“
Mit Prosper Haniel schloss am 21. Dezember die letzte deutsche Steinkohlen-Zeche. Der Abschied vom Bergbau weckt bei vielen Lesern Erinnerungen an harte Arbeit, Grubenunglücke und glückliche Kindertage im Schatten der Fördertürme. Wir bedanken uns für die vielen Zuschriften unserer Leser. Eine kleine Auswahl.
Marianne Sieg: Jeder Pfennig war wichtig
Ich bin Tochter eines Bergmanns. Es war ein harte Kampf gegen die Schließung der Zeche Sophia Jacoba in Hückelhoven, der verloren wurde. Meine Erinnerung begann 1960. Wir zogen in das von der Zeche angebotene Haus. Wir kamen mit unseren Habseligkeiten, wahrlich nicht viele. Für uns Kinder war es spannend. Es entwickelte sich die Siedlungsgemeinschaft. Als ich in die Schule kam, stellte ich fest, dass es noch eine Gemeinschaft gab – die Dorfgemeinschaft. Ein kleiner gewachsener Ort mit Schule und Kirche, in die wir gehen mussten. Die lange Landstraße trennte uns: auf der einen Seite wir, auf der anderen die Dorfbewohner. Ich glaube, dass Dorfkinder nicht mit Siedlungskindern spielen durften. Irgendwann hat sich eine junge Frau aus dem Dorf in einen jungen Mann aus der Siedlung verliebt.
Ich habe miterlebt, wie Familien die traurige Mitteilung bekamen, dass ihr Vater nicht mehr nach Hause kommt. Die große Traurigkeit, die Beerdigung. Die Bergkapelle spielte „Ich hatte eine Kameraden“. Die Gespräche darüber, dass man nie weiß, wer der nächste ist. Das Gefühl, wenn der Vater nicht pünktlich nach Hause kam, weil er eine Doppelschicht machte. Jeder Pfennig war wichtig. Man konnte sich ja nicht kurzfristig verständigen, dass es später wird, Telefon gab es nicht.
Der Handel stellte sich auf uns ein. Man konnte sich längst nicht das kaufen, was man wollte. Sollte es etwas mehr sein, konnte man beim Händler anschreiben lassen. Dann wurden wir Kinder geschickt, peinliche Angelegenheit. Es konnte dann in Raten abgestottert werden.
Die Steinkohle hat Einheimische und Fremde (viele waren Flüchtlinge oder Gastarbeiter) zusammengebracht.
Folkmar Pietsch (Wegberg): Wassereinbruch unter Tage
Es war der 13.September 1975, ein Samstag. Ich hatte Wochenenddienst bei der Zeitung und erfuhr am Morgen von einer Katastrophe bei der Zeche Sophia Jacoba in Hückelhoven. In der Nacht hatte sich ein Wassereinbruch ereignet – in 400 Meter Tiefe war das Wasser mit bis zu 20000 Liter in der Minute aus dem 320 Meter tiefen Deckgebirge in den Streb geschossen. Die 441 Kumpel der Nachtschicht konnten gerettet werden. Doch der Wassereinbruch sorgte für katastrophale Zerstörungen in der Feierabendsiedlung im benachbarten Wassenberg. Vor den Häusern türmten sich Möbel, in den Fahrbahnen und an Hauswänden entstanden andauernd neue Risse. Menschen liefen schreiend umher: „Der Berg, der Berg, die Häuser stürzen ein.“ Überall knackte und knirschte es furchterregend. Die Erde senkte sich.
Bis zum Samstagmittag mussten 17 Familien mit 35 Personen aus 15 Häusern wegen akuter Einsturzgefahr evakuiert werden, und in der Nacht zum Sonntag wurden weitere zwei Häuser geräumt, so dass letztlich 84 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Sie alle kamen in Hotels und Pensionen sowie leerstehenden Wohnungen unter. Währenddessen waren Hunderte Kumpel pausenlos dabei, über 30.000 Sandsäcke zu füllen und hinab in den etwa 400 Meter tiefen Schacht zu bringen, um damit Dämme zu errichten. Ferner setzte man zahlreiche Pumpen ein, um der Wassermassen Herr zu werden. Am Sonntag kam Ministerpräsident Heinz Kühn mit seinem halben Kabinett, um sich ein Bild von der Katastrophe zu machen und dem Unternehmen mit damals 4200 Beschäftigten sämtliche erforderliche Unterstützung zuzusagen.
Dann begannen aufwändige Arbeiten, die sich bis 1976 hinzogen. Ob es die Bereitschaft zum Wiederaufbau gegeben hätte, wenn die Kumpel damals geahnt hätten, dass 16 Jahre später der Stilllegungsbeschluss gefasst und am 27.März 1997 vollzogen wurde?
Paul Mackes (Viersen): Abenteuer Deputatkohle
Mein Opa Hermann lebte mit Oma Johanna in Moers. Sie wohnten Anfang der 50er Jahre in einem Reihenhaus der Zeche zur Miete. Opa hat über 40 Jahre auf der Zeche Rheinpreußen gearbeitet. Opa hat immer über Tage gearbeitet, unter Tage wollte er nie. Viele auf der Zeche erhielten nach ihrer Pensionierung lebenslang Deputatkohle mit Grubenholz für den Eigenbedarf. Vor dem Haus war ein Schacht mit einem Deckel abgedeckt. Der Schacht war als Kohlerutsche in den Keller ausgebaut.
Ich war bei Oma und Opa in Ferien, als die jährliche Deputatkohle angeliefert wurde. Der Lkw kippte die Kohle in den Schacht, das Grubenholz wurde vorher abgeladen. Opa stand im Keller mit einer großen Schaufel und beförderte die rutschende Kohle sofort in eine dafür vorgesehene Ecke im Keller. Ich war sechs Jahre und wollte unbedingt sehen, wohin die Kohle verschwand. Also stellte ich mich ganz nah an den Schacht, um hinabzusehen, bekam Übergewicht und rutschte samt Kohle in den Keller auf die Schaufel von meinem Opa. Alles ging gut, und ich sah aus wie Bergleute nach der Schicht. Gegen meinen Willen steckte Oma mich sofort in die Wanne.
Christian Holland (Emmerich): Angeworben in Flensburg
Was macht ein Abiturient 1952, der noch nicht weiß, wohin der Weg gehen soll? Der auch kein Geld hat, um zu studieren? Er sucht erst einmal eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Auf dem Arbeitsamt in Flensburg trifft er zufällig auf eine Bergwerkskommission. Er solle an die Hibernia AG in Herne schreiben und sich dort bewerben, die Hinfahrt ins Ruhrgebiet werde bezahlt. So begann mein Weg ins Bergwerk.

Bundespräsident Steinmeier bekommt das letzte Stück Kohle
Kurze Zeit später schrieb ich in mein Tagebuch: Zeche Gottfried Wilhelm! Es ist geschafft. Die Behandlung bei den Untersuchungen war entwürdigend. 40 nackte Männer auf einem Haufen. Und das nach im D-Zug durchwachter Nacht. Stundenlanges Warten in verqualmten Räumen. Alle todmüde. Aber das zugewiesene Zimmer ist nett und sauber. In der Kantine gibt es alles, daher gilt es, die Moneten zusammenzuhalten. Einen Lederhelm erhielt ich im Magazin, er kostete mich 3,50 Mark. In der Kaue zieht man sich das Arbeitszeug an und hängt das andere auf einen Haken, der bis unter die Decke gezogen wird. Am Förderkorb wird man seine Fahrtmarke los. Der Korb ist dreistöckig und fasst 48 Mann. Wie Heringe stehen die Kumpels da drin.
Nach der Schicht wurde der Werkstudent manchmal eingeladen zu einem Bier. Das gab es in kleinen Gläsern zu 0,1 Liter, dazu immer einen Schnaps. Unter den Kumpeln fühlte ich mich wohl und der tiefe Einblick in ihre Arbeitswelt war für immer prägend.
Horst Soltysiak: Behütete Kindheit im Ruhrpott
„Wer im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, hat zwei Gene in sich vereint. Er weiß, was Zusammenhalt und Respekt bedeuten. Meine Kindheit habe ich im Pott verbracht. Ich habe in unserer Zechen Siedlung eine behütete Kindheit erlebt. Auch damals gab es schon im Ruhrpott Migration. Wir Kinder spielten aber zusammen, und unsere Väter lehrten uns, was es bedeutet, unter Tage Kumpel zu sein. Dieses spiegelte sich im täglichen Miteinander wieder.
Die Zeiten waren hart. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vor dem Besuch der Schule für die Mutter die frische Milch beim Kaufmann um die Ecke zu holen. Danach waren die Kniften (heute Pausenbrote) gepackt, und es konnte mit den anderen Jungen zu Fuß in die Volksschule aufgebrochen werden. Für den Nachmittag verabredeten wir uns zum Spielen auf dem Fußballplatz, meistens war es die Siedlungsstraße. An den Wochenenden gab es frischen Streuselkuchen, für uns Kinder war es immer ein Highlight. Ebenso unsere Schrebergärten, die fast jeder Bergmann hatte. Wir Kinder wussten, wie jenes entsteht und wächst, was wir unabhängig von der Jahreszeit (aus Einmachgläsern) zu essen bekamen.
Es gab auch Schattenseiten. Wir erlebten Väter, die durch die harte Arbeit gezeichnet waren und sehr oft ihre Rente nicht mehr erlebten. Alles wurde geteilt. Freud, aber auch Leid. Man wusste, dass jemand da war und man nie mit seinen Sorgen und Nöten allein war. Kumpel zu sein wurde zur Lebensphilosophie. Ich bin später aus dem Ruhrgebiet fortgezogen. Meine Heimat und mein Herz sind aber im Pott geblieben. Einmal Kumpel, immer Kumpel. Deutschland hat den Bergleuten viel zu verdanken.
Erika Grenz-Heeger (Schwalmtal): Grubenunglück von Bergkamen
Mein Onkel, Diplom-Ingenieur Karl Bühling, war nach Kriegsende als Direktor der Essener Steinkohlenzechen zur Grube Grimberg III/IV des Bergwerks Haus Aden/Monopol in Bergkamen-Weddinghofen gewechselt und hatte dort von Anfang an für dringend notwendige Sicherheitsmaßnahmen plädiert. Ich war damals 22 Jahre alt und freute mich, dass mein Onkel mich in seinem Betrieb als Dolmetscherin anstellen wollte. Es war die Zeit der Nachkriegsbesatzung, die Zechen standen unter britischer Kontrolle.
Für den 20. Februar 1946 hatte sich endlich ein Team aus britischen Offizieren und Bergfachleuten für neun Uhr angesagt, um die Wünsche meines Onkels anzuhören. Leider kamen sie erst mit zwei Stunden Verspätung. Das waren zwei Stunden zu spät für die britischen Besucher, meinen Onkel und über 400 Bergleute: Schlagende Wetter führten am späten Vormittag zu Explosionen und Feuersbrünsten unter Tage, die von der Feuerwehr nicht gelöscht werden konnten. Die Brandschächte mussten zugemauert werden – mit den Kumpeln darin! Man hoffte nur, dass vor dem Einmauern niemand von ihnen mehr lebte.
Ich selbst war später bei der Trauerfeier dabei, habe einen Kranz niedergelegt und bin nicht Zechendolmetscherin geworden.
Ulrich Seibring (Krefeld): Ein Stück Kernseife
Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, geboren 1950 in Gelsenkirchen-Heßler. Die ersten 26 Jahre habe ich im Dunstkreis von Altenessen gelebt. Zechen wie Emil Emscher, Fritz, Helene und Karl samt ihren Kokereien waren prägend für unseren Stadtteil. Meine Großväter waren beide im Bergbau beschäftigt. Der eine als Maschinenschlosser, der andere als Zechendirektor.
Meine erste direkte Berührung mit dem Steinkohlebergbau hatte ich als Schüler der Unterprima. In den drei Wochen Osterferien arbeitete ich auf der Zeche/Kokerei Emil-Emscher in der Frühschicht sechs bis 14 Uhr. Wir Aushilfskräfte mussten pünktlich um sechs Uhr am Eingang in voller Arbeitskleidung die Stechuhr bedienen.
Das hieß sehr frühzeitig mit dem Fahrrad von Hause aus zur Zeche. In der Weißkaue die Straßenkleidung ausziehen, am Haken nach oben ziehen, durch die Waschkaue in die Schwarzkaue, um dort die Arbeitskleidung vom Haken zu holen. Untertage durften wir natürlich nicht arbeiten. Wir wurden zum Beispiel zur Innenreinigung des Gaskessels und zur Arbeit auf der Kokerei, etwa zum Auskleiden der Koksbatterien mit Schamottsteinen eingesetzt. Die Arbeit auf dem Dach der Kokerei war natürlich sehr schmutzig. Wenn die Koksbatterien gefüllt wurden, gab es häufig große Rußwolken, die uns von oben bis unten schwarz machten.
Nach Schichtende versuchten wir, uns mit den Kumpeln von Untertage in der Waschkaue zu säubern. Da gab es natürlich nur eine Stück Kernseife. Traditionell stellten wir uns hintereinander in einen Kreis, um dem Vordermann den Rücken zu waschen. Nur für die Augenpartie gab es eine Spezialcreme.
Dabei erinnere ich mich an einen Kumpel, der vor dem Spiegel stand und sagte: „Ich steh hier und versuche mich das Schwatte aus den Augen zu kriegen, und meine Olle steht jetzt zu Hause vorm Spiegel und versucht, sich das Schwatte inne Augen zu kriegen. Datt versteh, wer will; aber schön isset doch.
Meine Mitschüler vom Leibniz-Gymnasium in Altenessen werden im Frühjahr 2019 den 50. Jahrestag unseres Abiturs feiern. Natürlich im Hotel Mitten im Pott in Bottrop. Besitzer ist die Familie Lippens. Willi Lippens war damals unser Held bei Rot-Weiß Essen.
Angelika Stobbe (Niederkrüchten): Mit Ende 60 auf der Zeche
Mit dem Lied „Glück auf, der Steiger kommt“ haben wir 2009 Abschied von meiner Mutter Erika Kontenak genommen, die eine begeisterte Bergmannstochter war. Meine Mutter und ihre Eltern stammten aus dem niederschlesischen Kohlebergbaugebiet um Waldenburg, das heute zu Polen gehört. Mit der Patenstadt Dortmund fühlte sie sich zeitlebens verbunden, hier bildete sich nach dem Zweiten Weltkrieg der Patenstadtarbeitskreis Waldenburger Bergland/Dortmund, der bis 2008 alle zwei Jahre das Waldenburger Heimattreffen in der Westfalenhalle veranstaltete.
Mein Großvater, Josef Meissner (1897-1976), war ein wackerer Bergmann. Er hatte ein sehr hartes und schweres Berufsleben, das aber durch die gute Kameradschaft der Bergleute ausgeglichen wurde. Nach dem Krieg und dessen Wirrungen, die ihn ins Rheinland verschlugen, arbeitete er noch auf einer Zeche in Essen, da war bereits Ende 60! Mein Großvater brachte noch Familienmitglieder bei der Zeche zur Arbeit unter. Das Schaffen unter Tage forderte seinen Tribut. Wegen einer Staublunge und weil er sich um meine Betreuung kümmern wollte, setzte er seine geliebte Arbeit nicht mehr fort. Das Foto zeigt meinen Großvater um 1925 in Waldenburg/Schlesien. Stolz präsentiert er sich in der geliehenen Bergmannsuniform. Für eine eigene fehlte das Geld.